
NGN-2: Negativ gepfeilter Nurflügel Nr. 2
Seit dem Bau und dem Bericht
zum NGN-1 ist schon einige Zeit vergangen. Das Thema negativ gepfeilte Nurflügel
hat mich jedoch seither nicht mehr losgelassen. In der Zwischenzeit habe ich
weiter an meinen Entwürfen gearbeitet und konnte die Flugeigenschaften meiner
vorgepfeilten Modelle weiter verbessern. In diesem Bericht möchte ich den
Nachfolger vom NGN-1 vorstellen, der bereits 2014 seinen Erstflug hatte und
schon an mehreren IGNF-Treffen dabei war. Einen gut klingenden Spitznamen hat
auch er bis heute nicht erhalten, deshalb nennen wir ihn bei seinem
Platzhalternamen NGN-2.

Lehren aus der ersten
Prototypengeneration:
Der NGN-2 entstand aus den
Lehren, welche ich aus den Versuchen mit meinen ersten beiden Versuchsmodellen
Proto-1 und NGN-1 gezogen habe. Diese beiden Modelle waren, wie im Bericht zum
NGN-1 beschrieben noch recht dürftig im Flugverhalten (schlechtes
Abrissverhalten) und auch konstruktiv gab es noch Luft nach oben (hohes
Abfluggewicht und viel Trimmblei). Mit den gesammelten Erfahrungen aus dieser
ersten Prototypengeneration war dann der Zeitpunkt gekommen einen verbesserten
Nachfolger zu entwerfen.
Die Flügel des NGN-1 wählte
ich damals bewusst so einfach wie möglich. Das heisst sie hatten durchgehend das
gleiche Flügelprofil, keine Verwindung und nur eine schwache Zuspitzung. Da sich
bei meinen Recherchen die spärlichen Quellen in der Literatur und im Internet
zur Auslegung für negativ gepfeilte Nurflügel teils widersprachen (negative bzw.
positive Verwindung zum Flügelende), sah ich darin die beste Ausgangslage für
einen ersten Versuch.
In der Praxis erwies sich
dieser sehr einfach ausgelegte Flügel als gar nicht mal so schlecht. Zu
bemängeln war hauptsächlich das schlechte Abriss- und Auffangverhalten. Die für
meinen Geschmack zu hohe Mindestfluggeschwindigkeit beider Modelle, unabhängig
vom Abfluggewicht, war ebenfalls noch verbesserungswürdig.
Am Proto-1 testete ich im
Vorfeld noch verkleinerten Steuerklappen, die vorher über die gesamte
Flügelspannweite, mit Trennung bei Halbspannweite, verliefen. Die verkleinerten
Klappen mit jeweils der Länge eines Viertels der Flügelhalbspannweite (bündig an
der End- und Wurzelrippe) erwiesen sich als ausreichend. Ich entschied mich auch
definitiv dazu nur noch die Innenklappen als Höhenruder zu verwenden und nicht
mehr alle Klappen zusammen. Die Querruder waren bei allen Modellen immer nur auf
den Aussenklappen. Zu Vergleichszwecken mischte ich die Querruderklappen
manchmal noch per Schalter zum Höhenruder dazu, was ausser einem grösseren
Höhenverlust in engen Kurven kaum einen Unterschied für die Steuerbarkeit
machte. Minder wendig wird das Modell dadurch nach meiner Auffassung nicht.
Strömungsabriss:
Das gravierendste Problem
meiner ersten Generation Vorgepfeilter war das Strömungsabrissverhalten. Dies
führte in sicher neunzig Prozent der Strömungsabrisse zu einem nicht mehr
kontrollierbaren Trudeln und Absturz. Das Modell aufzufangen war in diesen
Situationen nicht mehr möglich.
Typischerweise beginnt der
Strömungsabriss bei nicht verwundenen Flügeln mit negativer Pfeilung bei der
Wurzelrippe und verteilt sich von da weg über die Hinterkante über die gesamte
Tragfläche. Somit reisst die Strömung als erstes an der Stelle ab, an der sich
die Höhenruder-Klappen befinden. Der Pilot hat dadurch keine Chance mehr die
Situation mittels „Tiefe geben“ zu entschärfen. Durch den abnehmenden Auftrieb
im Heckbereich bäumt sich das Modell nur noch zusätzlich auf und der
Strömungsabriss schreitet weiter fort.
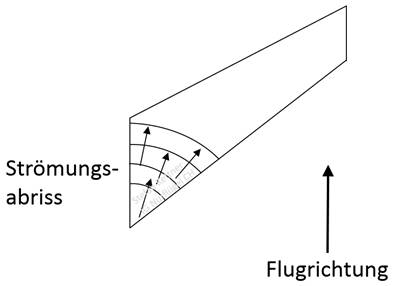
Um das Abrissverhalten zu
verbessern, griff ich auf eine Überlegung von IGNF-Kollegen Stefan Engel zurück.
Sein Vorschlag war es die Flügel durch lokale Erhöhung des Anstellwinkels so zu
verwinden, dass man ein Strömungsabriss gezielt an einer Stelle zuerst eintreten
lässt. Konkret dort wo der angreifende Auftrieb (t/4 Linie) auf dem Schwerpunkt
zu liegen kommt und beim Wegfallen keine Drehung um die Querachse verursacht
würde, da dort der Hebelarm gleich null ist und somit das resultierende
Drehmoment verschwindet. So würde das Modell sich nicht mehr aufbäumen, sondern
zuerst anfangen abzusacken. Dank der an den Flügelenden und im Wurzelbereich
noch immer anliegenden Strömung wären sämtliche Klappen noch wirksam und der
Pilot hat die Möglichkeit die Fluglage zu korrigieren.
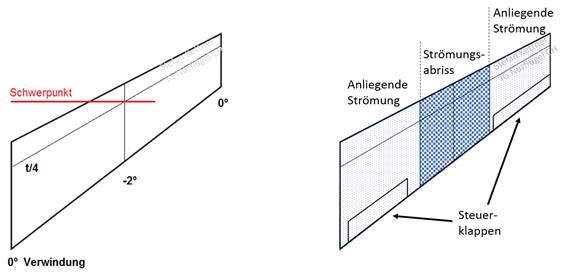
Am Proto-1 überprüfte ich
diese Theorie kurzerhand mittels fix ausgefahrenen Klappen (Flaps), die einen
ähnlichen Effekt erzielen sollten. Je nach Ausschlag der Flaps verändert sich
das Flügelprofil an den entsprechenden Stellen des Flügels, wodurch ein
Strömungsabriss, relativ zum restlichen Flügel, beschleunigt respektive
verzögert werden kann. Es stellte sich heraus, dass die Variante mit nach oben
ausgefahrenen Flaps das Flugverhalten kurz vor dem Strömungsabriss und im
Auffangen nachher deutlich verbesserte.
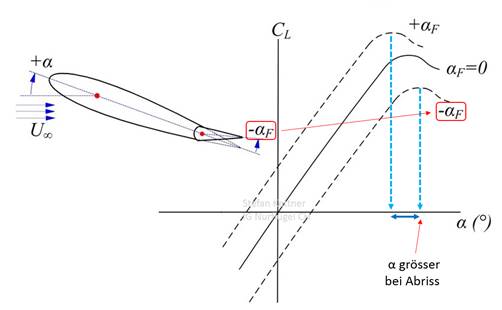
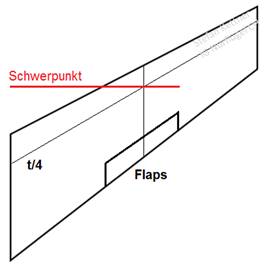
Entgegen den Erwartungen
machten die nach unten gestellte Flaps, die nach der ursprünglichen Idee ein
Strömungsabriss im Bereich des Schwerpunkts beschleunigt hätten, das Modell
deutlich bockiger und mühsamer zum Fliegen. Im Vergleich zur anderen Variante
war ausserdem viel mehr Höhenrudertrimmung nötig, um das Modell in der Luft zu
halten. Zur Überprüfung dieser Beobachtungen durch eine effektive Verwindung der
Flügel anstelle der Flaps entstand ein neuer schnell und einfach- gebauter
Prototyp (Proto-2). Umgesetzt wurde die Variante, die sich bei den Versuchen mit
den Flaps bewährt hatte. Das heisst, die Flügel wurden beim Schnittpunkt von
t/4-Linie und Schwerpunkt negativ verwunden.
Der zweite Prototyp
(Proto-2) war mit 2 Metern Spannweite grösser als sein Vorgänger Proto-1 (1.4
Meter) und verfügte ausserdem über leicht zugespitzte Flügel. Dieses Modell
bewies erneut zufriedenstellende Flugeigenschaften und gutes Abrissverhalten,
worauf ich all seine Eckdaten unverändert für den Bau des NGN-2 in stabilerer
Holzbauweise übernahm.
Natürlich wirkt sich diese
Flügelverwindung auch auf die Zirkulationsverteilung aus, die dadurch nicht mehr
der angestrebten elliptischen Form entspricht. Die Delle in der
Zirkulationsverteilung, welche durch die lokale negative Verwindung entstand,
ist in der Abbildung unten deutlich erkennbar. Die Tragflächen haben folglich
nicht den kleinsten induzierten Widerstand, fürs Erste wurde dies aber so
akzeptiert.
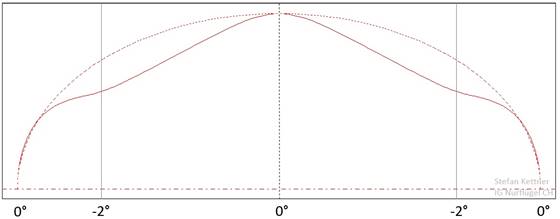

Bau des NGN-2
Bau der Flügel
Beim Bau der Flügel galt es
hauptsächlich massiv leichter zu bauen als beim deutlich zu schweren Vorgänger
NGN-1. Die Sandwichbauweise hielt ich bei, allerdings mit folgenden Massnahmen
zur Gewichtsreduktion:
Für die Balsabeplankung
reduzierte ich die Dicke von 2 auf 1.5 mm. Zusätzlich wählte ich bewusst die
leichteren weichen Balsabrettchen aus. Selbst mit Hartgrund-Lackierung wogen
diese bei derselben Fläche und Dicke nur knapp halb so viel wie die härtesten
Brettchen meines Balsavorrats. Für die Glasseidenverstärkung zwischen Styro-Kern
und Beplankung verwendete ich nur noch 25er (g/m^2) Seide und mit dem Klebstoff
versuchte ich sparsamer umzugehen.
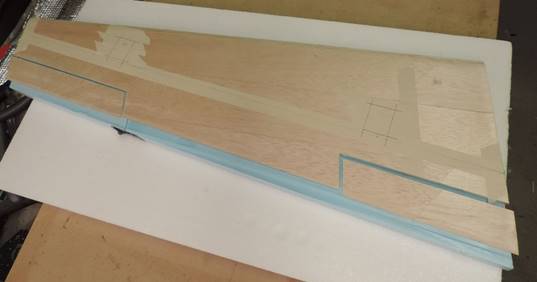
Bau des ersten Rumpfes
Beim NGN-1 hatte ich das
Problem, dass ich trotz des langen Rumpfes noch viel Blei in die Nase packen
musste, um den Schwerpunkt auf die richtige Position zu bringen. Der neue Rumpf
wollte ich deshalb so konstruieren, dass die Trimmung nur durch das Gewicht des
Motors, des Reglers und des Akkus ohne zusätzliche Bleigewichte erreicht werden
kann. Die Feintrimmung sollte nur noch durch das Verschieben des Akkus möglich
sein. Der Akku müsste ungefähr in der Mitte zwischen Motor und Schwerpunkt zu
liegen kommen, um notfalls noch genügend Platz zum Vor- oder Zurückschieben zu
haben.
Zuerst baute ich die Flügel
im Rohbau fertig, da deren Gewicht entscheidend für die Trimmung waren. Der
Schwerpunkt der Flügel allein liegt nämlich hinter dem Schwerpunkt des fertigen
Modells und muss durch das Gewicht des ganzen Rests des Modells ausgeglichen
werden. Da das Gewicht und der Massenmittelpunkt der Flügel vorgegeben waren,
konnte die Gewichtsverteilung nur noch durch die Dimensionierung des Rumpfes und
der Positionierung von schweren Komponenten wie Motor, Regler und Akku (oder
Blei) beeinflusst werden. Es war deshalb entscheidend, wie lange der Rumpf
gebaut wurde, da die elektronischen Komponenten in der Rumpfspitze so einen
grösseren oder kleineren Hebelarm erhielten.
Die dafür notwendige
Rumpflänge bestimmte ich wie folgt. Die Flügel montierte ich an eine Holzlatte,
welche ich relativ zu den Flügeln so positionierte, dass deren Mitte auf dem
zuvor berechneten Schwerpunkt des Modells zu liegen kommt. Dadurch lagen die
Schwerpunkte der Holzlatte und des Modells auf demselben Punkt, wodurch das
Gewicht der Holzlatte die Ausbalancier-Prozedur nicht beeinflussen sollte.
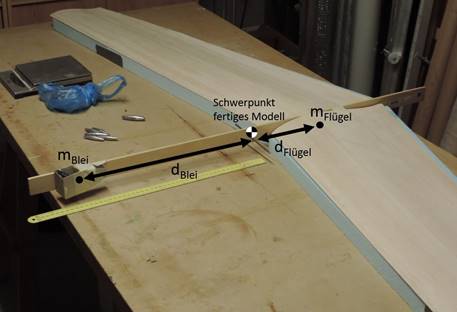
Dieser Aufbau wurde
anschliessend auf dem Schwerpunkt des Modells auf einer Metallstange durch die
Mitte der Holzlatte aufgebockt. In eine am Ende der Holzlatte angeklebten
Kartonwanne mit bekanntem Abstand zum Schwerpunkt füllte ich so viel Blei, bis
der ganze Aufbau ausbalanciert war. Das Gewicht des Bleis multipliziert mit
dessen Abstand zum Schwerpunkt entspricht dem Drehmoment, dass die Flügel
bezüglich des Schwerpunktes ausüben und vom Motor, Regler und Akku kompensiert
werden müssen. Anhand der bekannten Massen von Motor, Regler und Akku konnte ich
nach dem Hebelgesetz deren Abstand zum Schwerpunkt berechnen.
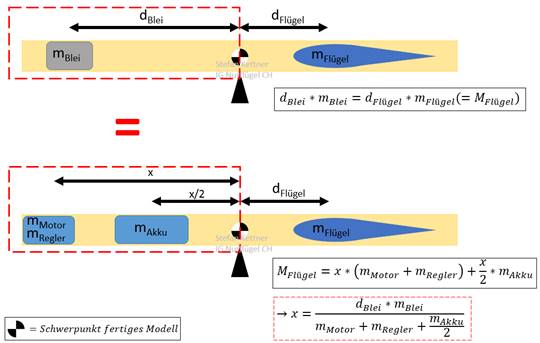
Das Gewicht des Rumpfes
selbst erzeugt natürlich auch ein Drehmoment bezüglich des Schwerpunktes. Ich
nahm aber an, dass dieser Einfluss vernachlässigbar klein ist. Grund dafür war,
dass beim NGN-1 und meinen anderen negativ gepfeilten Prototypenfliegern die
Schwerpunkte der Modelle praktisch immer in der Mitte der Rümpfe zu liegen
kamen. Dadurch wird der Hebelarm des Rumpfschwerpunktes zum Modellschwerpunkt
und somit auch dessen Drehmoment verschwindend klein.
Zufälligerweise ergab die
Berechnung eine Rumpflänge, die praktisch identisch mit der des NGN-1 war. Auch
äusserlich baute ich den Rumpf ähnlich zum Vorgängermodell auf. Der einfache
Kastenrumpf ist in seinem Aufbau nicht weiter speziell, deshalb gehe ich hier
nicht weiter auf dessen Bau ein.


Bau des zweiten Rumpfes
Nachdem das Modell rund drei
Jahre im Einsatz war, wollte ich es optisch ein wenig aufwerten und seinen
klobigen eher unansehnlichen Rumpf, der damals möglichst schnell gebaut werden
sollte, durch einen Neuen ersetzen. Für die Konstruktion der Haube und der Form
des vorderen Rumpfteils (Nase bis Hinterkante Haube) orientierte ich mich am
Tigerhai von Wolfgang Werling, dessen Optik und grosszügige Platzverhältnisse
mich überzeugten. Das Heck liess ich spitz zulaufen. Der ganze Rumpf sollte in
der Seitenansicht tropfenförmig und somit möglichst aerodynamisch geformt sein.
Im Heckbereich bei der Flügelsteckung wollte ich den Rumpf allerdings nicht zu
filigran bauen und liess dort den Rumpf so hoch wie möglich. Zur Verstärkung
dieser Rumpfsektion und zum passgenauen Einbau der Steckungsrohre und der
Flügelsicherung (alle mussten exakt auf die bereits fertigen Flügel passen)
baute ich die unten abgebildete zusammensteckbare Frästeilkonstruktion aus
Sperrholz ein.



Für die Rumpfwände
verwendete ich 5mm dickes Balsa und sämtliche Spanten und Frästeile für die
Kabinenhaube bestanden aus ebenfalls 5mm dickem Sperrholz.
Für das Seitenruder klebte
ich drei Lagen 2mm dickes Balsaholz aufeinander, wobei die Faserrichtung der
mittleren Schicht um 90° zu den äusseren gedreht war. Diese Variante war
deutlich stärker als die aus Balsaleisten zusammengesetzte Version beim ersten
Rumpf und durch gewichtsreduzierende Löcher war sie nicht mal sonderlich viel
schwerer. Bei der Optik des Seitenruders wollte ich ebenfalls etwas Neues
ausprobieren und wählte eine stark verrundete Form, wie man sie von
Oldtimer-Segelflugzeugen kennt.

Flugeigenschaften
Beim Flugverhalten gab es
keine grossen Überraschungen. Das Abrissverhalten, war wie im Vorfeld an den
einfach gebauten Prototypen ausgetestet, absolut problemlos. Wird im
Geradeausflug mässig am Höhenruder gezogen, nimmt das Modell seine Nase leicht
rauf, verlangsamt und kippt schlussendlich über die Querachse nach vorne und
leitet selbst einen Auffangbogen ein. Das angestrebte Ziel, das Modell leichter
als sein Vorgänger (NGN-1) zu machen, konnte ebenfalls erreicht werden. Von
knapp 3kg konnte das Abfluggewicht auf 2kg reduziert werden. Fürs Erste
ausreichend, in Zukunft soll da aber noch mehr gehen.
Zu bemängeln ist, dass das
Modell im steilen Kurvenflug zu viel an Höhe verliert. Gerade beim
Thermikkreisen ist diese Eigenschaft sehr kontraproduktiv, wodurch die
eingebaute E-Thermik viel öfter als gewünscht eingesetzt werden muss. Beim
nächsten Modell werde ich diesem Punkt auf jeden Fall ausführlicher nachgehen.
Alles in allem macht der
Flieger sehr viel Spass und ist ein grosser Schritt vorwärts im Vergleich zu
seinem Vorgänger. Ihm werden sicher noch weitere überarbeitete Modelle folgen.
Flugvideos zu den im Bericht erwähnten Modellen
sind unter folgendem Link auf YouTube zu sehen:![]()





Auslegungsansätze
und Einsatz in der manntragenden Fliegerei
Stefan Kettner, 2014/2021